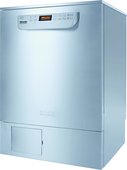Inhaltsverzeichnis
- Instrumentenaufbereitung Definition
- Gesetzliche Vorschriften und RKI-Empfehlung
- Risikoklassen: unkritisch, semikritisch, kritisch
- Instrumentenreinigung, -desinfektion und -sterilisation
- Validierung der Instrumentenaufbereitung
- Maschinelle Instrumentenaufbereitung
- Manuelle Instrumentenaufbereitung
- Instrumentenaufbereitung in einzelnen Fachbereichen: von Zahnarztpraxis bis Tierarzt
Instrumentenaufbereitung Definition
Die Instrumentenaufbereitung ist ein Prozess zur Aufbereitung von wiederverwendbaren Medizinprodukten. Das Infektionsrisiko von Patienten und Personal durch benutzte und mit Mikroorganismen kontaminierte Diagnose- oder Behandlungs-Geräte (Endoskope, Katheter, Pinzetten, Mundspiegel etc.) kann so erheblich minimiert werden. Der Ablauf der Medizinprodukteaufbereitung ist abhängig von der Risikoklasse, den Herstellerangaben und den örtlichen Gegebenheiten. Sie wird meistens maschinell mit Hilfe von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und ggf. Sterilisatoren vollzogen.
Gesetzliche Vorschriften und RKI-Empfehlung
Die Instrumentenaufbereitung ist in MPBetreibV § 8 gesetzlich festgehalten. Demnach hat die Aufbereitung gemäß Herstellerangaben mit geeigneten validierten Verfahren zu erfolgen, sodass die Sicherheit von Anwender, Patient und Dritte nicht gefährdet wird. Die Wiederaufbereitung darf nur von Personen durchgeführt werden, die konform mit MPBetreibV § 5 sind.
Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine Empfehlung zum Thema “Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten” veröffentlicht. Das RKI “vermutet”, dass die Orientierung an diesem Dokument eine ordnungsgemäße Aufbereitung sicherstellt. Auch wir orientieren uns an diesem Dokument und bereiten die wichtigsten Informationen daraus für Sie leicht verständlich und kompakt auf.
Risikoklassen: unkritisch, semikritisch, kritisch
Die “Gründlichkeit” der Instrumentenaufbereitung ist abhängig von der Risikoklasse des Medizinprodukts. Die Klassifizierung hat gemäß Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten zu erfolgen. Wird von den Herstellerangaben abgewichen, so ist dies zu begründen und zu dokumentieren. Ist die Zuordnung unklar oder sind auf das Produkt mehrere Regeln anwendbar, so ist stets die höhere Risikoklasse zu wählen.
Im Kern richtet sich die Risikoklasse danach, ob ein Produkt nichtinvasiv oder invasiv eingesetzt wird. In der Folge ergeben sich folgende Klassen:
- unkritisch (Klasse I)
- semikritisch A und B (Klasse IIa, IIb)
- kritisch A, B und C (Klasse III)
Beispiel: EKG-Elektroden werden als “unkritisch” eingestuft. Ultraschallsonden bedürfen etwas mehr Reinigungs- und Desinfektionsaufwand und sind in der Klasse “semikritisch A” verortet, Röntgenanlagen haben ein Erhöhtes Risikopotenzial und fallen in Klasse IIb.
Die Risikoklasse “Kritisch A/B” setzt zwangsläufig eine Sterilisation voraus. Nachfolgend eine Übersicht einiger Beispiele:
Risikoklassen und Medizinprodukte
| Name | Anz. (fiktiv) | Risikoeinstufung | Vorreinigung | Reinigung + Desinfektion | Spez. Kennzeichnung | Sterilisation |
| EKG-Elektroden | 12 | Unkritisch | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ohrtrichter | 5 | Semikritisch A | Optional | Ja | Nein | Optional |
| Spekulum | 3 | Semikritisch A | Optional | Ja | Nein | Optional |
| Flexible Endoskope (z. B. Gastroskop) | 2 | Semikritisch B | Ja | Ja | Nein | Bei Einsatz in sterilen Körperhöhlen |
| Wundhaken | 5 | Kritisch A | Optional | Ja | Nein | Ja |
| MIC-Trokar | 4 | Kritisch B | Ja | Ja | Optional | Ja |
| ERCP-Katheter | 2 | Kritisch C | Ja | Ja | Ja | Ja |
Quelle: DGKH
Bei am Patienten eingesetzten Geräten (kein Kontakt zum Patienten) ist die oberflächliche Reinigung mit material- und umweltfreundlichen Reinigungsmitteln ausreichend. Werden solche Geräte allerdings in keim-sensiblen Bereichen (Operationsräume, Isolierzimmer) eingesetzt ist eine desinfizierende Reinigung anzuraten.
Instrumentenreinigung, -desinfektion und -sterilisation
Die Instrumentenreinigung hat vornehmlich das Entfernen von sichtbarem Schmutz oder Rückständen (Blut, Gewebe, Sekret etc.) zum Ziel.
Die Instrumentendesinfektion ist eine Maßnahme zur gezielten Inaktivierung von Krankheitserregern. Ziel ist es die Ausbreitung oder Übertragung von Infektion durch kontaminierte Instrumente zu unterbinden. Die Anzahl der Infektionserreger wird auf ein Minimum reduziert
Die Sterilisation ist aggressiver als die Desinfektion und tötet vollständig und irreversibel sämtliche Keime ab. Ob ein Instrument desinfiziert oder sterilisiert werden muss ist abhängig von der Risikoklasse bzw. den Herstellerangaben.
Die Desinfektion kann entweder manuell oder maschinell durchgeführt werden. Prinzipiell ist stets die maschinelle Instrumentendesinfektion zu bevorzugen. Die maschinelle Reinigung- und Desinfektion kann thermisch, chemothermisch oder chemisch erfolgen. Das thermische Verfahren ist aufgrund der zuverlässigeren Wirksamkeit zu präferieren. Dieses Verfahren eignet sich jedoch nur für thermostabile Medizinprodukte.
Hinweis: Das Thermische Desinfektionsverfahren kann entweder mit trockener Wärme oder feuchter Wärme durchgeführt werden, je nachdem, ob Wasser zur Verfügung steht. Krankenhausinfektionen können nur mit feuchter Wärme wirksam bekämpft werden.
Ablauf: Instrumentenaufbereitung nach RKI
Damit Medizinprodukte ordnungsgemäß aufbereitet werden können ist eine Vorbehandlung der Instrumente unerlässlich. Genaue Sorgfalt ist bei jedem Schritt zu wahren, da beispielsweise bereits Fehler bei der Reinigung ein 100 % sicheres Ergebnis verhindern.
Der Ablauf der Instrumentenaufbereitung sieht dabei wie folgt aus:
| Arbeitsschritt | Besonderheiten |
| Vorbereitung der Aufbereitung und Vorreinigung |
|
| Reinigung |
|
| Zwischenspülung |
|
| Desinfektion |
|
| Spülung |
|
| Trocknung |
|
| Optische Kontrolle |
|
| Technisch-funktionelle Prüfung |
|
| Verpackung |
|
| Sterilisation |
|
| Kennzeichnung der Verpackung |
|
| Dokumentation und Freigabe |
|
| Lagerung (ggf. Transport) |
|
Dies ist der grobe Ablauf gemäß RKI. Ggf. können einige Arbeitsschritte herstellerabhängig oder abhängig von der jeweiligen Risikoklassen-Einteilung divergieren.
Im Optimalfall werden die Instrumente noch am Einsatzort (OP-Saal) dekontaminiert und behandelt, sodass das Antrocknen von Rückständen (Blut, Sekret etc.) verhindert wird. Die eingesetzten Reinigungsmittel und Verfahren bei der Vorreinigung sind auf die nachgelagerten Prozesse abzustimmen, damit nachteilige Effekte vermieden werden. Achten Sie darauf, dass alle inneren und äußeren Oberflächen in Kontakt mit den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kommen (fachgerechtes Zerlegen, Schallschatten vermeiden und Instrumente nicht übereinander positionieren). In keinem Prozessschritt darf es zu einer Fixierung von Rückständen kommen. Während der Reinigung sollte stets adäquate Schutzkleidung getragen werden.
Tipp: Hier finden Sie die Negativliste zur Instrumentenaufbereitung. Dort können alle nicht ordnungsgemäß abgelaufenen Aufbereitungsprozesse dokumentiert werden.
Tipp: Hier finden Sie die rote Broschüre zum Thema Instrumente werterhaltend aufbereiten.
Aufbereitungsraum: Unreiner und reiner Bereich
Die Instrumentenaufbereitung ist in einem gesondertem Aufbereitungsraum durchzuführen. Dieser ist durch einen unreinen und einen reinen Bereich zu trennen. Die Anlieferung von kontaminierten Medizinprodukten erfolgt im unreinen Bereich. Dort findet auch auch die Reinigung und Desinfektion sowie ggf. das Ultraschallbad und/oder die manuelle Vorreinigung statt. Anschließend findet im reinen Bereich die Sichtkontrolle, Verpackung und Sterilisation statt.
Der Aufbereitungsraum hat sich nicht nach einer konkreten Quadratmeterzahl zu richten. Dennoch sollte natürlich ausreichend Platz für den Arbeitsprozess sowie Gerätschaften vorhanden sein. Bei einem Neu-, Zu- und/oder Umbau einer Arztpraxis hat der Praxisinhaber jedoch einen separaten Aufbereitungsraum einzuplanen. In einer Bestandspraxis ist die Wiederaufbereitung auch in einem Behandlungszimmer gestattet, sofern bauliche Gegebenheiten eine Trennung verhindern. In diesem Fall ist eine zeitliche und hygienische Trennung zwischen Patientenbehandlung und Medizinprodukteaufbereitung zu gewährleisten und zu dokumentieren.
Externe Instrumentenaufbereitung
Die externe Instrumentenaufbereitung ist primär für Krankenhäuser oder Kliniken gedacht, die ihre Medizinprodukte nicht selbstständigen wiederaufbereiten können. Doch auch kleinere Praxen können auf fremde Dienste bzw. externe Betriebe, die die Wiederaufbereitung für Sie übernehmen, zurückgreifen, z.B. wenn das eigene RDG streikt.
Falls Sie also einmal in diese missliche Lage kommen sollten, dann empfiehlt es sich, nach einem Sterilgut-Service in Ihrer Nähe zu suchen.
Validierung der Instrumentenaufbereitung
Die Instrumentenaufbereitung unterliegt Normen und Gesetzen. Die Validierung des hierbei zum Einsatz kommenden Verfahrens liefert den dokumentierten Nachweis zum Erbringen, Aufzeichnen und Interpretieren der erforderlichen Ergebnisse. So kann sichergestellt werden, dass stets die gleichen Ergebnisse nach vorgegebenen Spezifikationen erzielt werden. Die Validierung setzt sich aus Installationsqualifikation, Betriebsqualifikation und Leistungsqualifikation zusammen.
Die Notwendigkeit der Validierung ist in § 8 Abs. 1 MPBetreibV geregelt:
Die Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten ist unter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers mit geeigneten validierten Verfahren so durchzuführen, dass der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern oder Dritten nicht gefährdet wird. Dies gilt auch für Medizinprodukte, die vor der erstmaligen Anwendung desinfiziert oder sterilisiert werden.
Diese Maßgabe betrifft den gesamten Prozess der Instrumentenaufbereitung inkl. der Vorreinigung und bezieht sich sowohl auf das maschinelle, als auch auf das manuelle Verfahren.
Hilfe bei der Validierung von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen finden Sie hier:
Hilfe und Informationen für die Validierung der Instrumentenaufbereitung
| Quelle | Information |
| RKI | Anlage 3: Inbetriebnahme und Betrieb von Reinigungs-Desinfektionsgeräten (RDG) zur Aufbereitung von Medizinprodukten (Checkliste) |
| Anlage 4: Inbetriebnahme und Betrieb von Kleinsterilisatoren zur Aufbereitung von Medizinprodukten (Checkliste) | |
| U.a. DGSV – Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung | Leitlinie für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte |
| Leitlinie zur Validierung der manuellen Reinigung und manuellen chemischen Desinfektion von Medizinprodukten | |
| DIN EN ISO 15883 | Definiert die Anforderungen an Reinigungs-Desinfektionsgeräte sowie an die Aufbereitungsprozesse. |
| DIN EN ISO 11138 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Biologische Indikatoren |
| DIN EN ISO 11140 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Chemische Indikatoren |
Beachten Sie, dass die Instrumentenaufbereitung nur denjenigen gestattet ist, die die Anforderungen gemäß § 5 MPBetreibV erfüllen oder unter Umständen Kenntnisse einer fachspezifischen Fortbildungsmaßnahme nachweisen können.
Maschinelle Instrumentenaufbereitung
Die maschinelle Instrumentenaufbereitung ist der manuellen vorzuziehen. Gründe hierfür sind die bessere Standardisierbarkeit und Reproduzierbarkeit sowie der Arbeitsschutz. Konstante relevante Parameter wie z.B. bei der Dosierung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Wasservolumina, Wasserdruck, Temperatur etc. können nur mit Gerätschaften erzielt werden - der Mensch ist fehleranfällig.
Besondere Aufmerksamkeit sollten Gerätekomponenten wie z.B. Hohlkörper, Innenkanäle, Scharniere, Ventile sowie rotierende oder oszillierende Instrumente zuteil werden, da diese schwer bzw. gesondert wiederaufzubereiten sind.
Ultraschallreinigungsgeräte
Das Ultraschallreinigungsgerät besitzt eine Ultraschallwanne, in die zu reinigende oder zu desinfizierende Medizinprodukte hineingelegt werden. In dem Ultraschallbad werden an den Instrumenten anhaftende Gewebe-, Sekret- oder Blutrückstände gelöst und beseitigt. Wie bei einem herkömmlichen Ultraschallgerät, sendet der Ultraschallreiniger Schallwellen in einem bestimmten Frequenzbereich (~40 khz) aus. Die eigentliche Schmutzbeseitigung funktioniert mit dem physikalischen Verhalten der Kavitation. Eingesetzt werden solche Geräte in der Arztpraxis, Krankenhaus, Klinik und im Labor und dienen der Wiederaufbereitung von bspw.:
- Mehrwerginstrumente (Pinzetten, Zangen, Skalpelle
- Zahnersatz, Kronen, Bohrer, Abdrucklöffel
- EEG- und EKG-Elektroden
- Endoskopzubehör (Ventile, Biopsiezangen, Schlingen)
Im Gegensatz zur manuellen Aufbereitung bietet die Ultraschallreinigung 5 Vorteile: sie ist sicherer, da eine Verletzung bspw. an spitzen oder scharfkantigen Instrumenten unwahrscheinlicher ist. Dies ist besonders von Interesse, da bei einer Desinfektion die Keimlast nur auf ein Minimum reduziert wird, eine mögliche Infektion durch Keime jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Zusätzlich reinigt ein Ultraschallreinigungsgerät effektiver und dringt auch mühelos in Bereiche vor, die sehr klein oder schwer zugänglich sind (Fugen, Bohrungen usw.). Ebenso dauert das Ultraschallbad lediglich 5 - 15 Min, je nach Konzentration des Lösungsmittel - in der Zwischenzeit kann die zuständige Person die Überbrückungszeit anderweitig nutzen. Auch ist die Instrumentenaufbereitung mit einem Ultraschallreinigungsgerät materialschonender, da keine Bürsten auf die Oberflächen einwirken. Ein weiterer Vorteil ist die Reproduzierbarkeit: anders als bei der manuellen Aufbereitung, liefert der Ultraschallreiniger stets dieselben Parameter und Qualität.
Das Ultraschallreinigungsgerät kann entweder reinigen oder reinigen und zusätzlich desinfizieren. Damit es effektiv arbeitet, gilt es einige Besonderheiten zu beachten:
- Instrumente müssen überlagerungsfrei in den Siebträger gelegt werden, sodass jedes Instrumente vollständig vom Lösemittel bedeckt ist und keine Schallschatten oder schalltote Bereiche entstehen
- Zerlegbare Instrumente vollständig zerlegen
- Lösemittel muss für den jeweiligen Anwendungszweck geeignet sein
- Einwirkzeit von Desinfektionsmitteln müssen unbedingt eingehalten werden
Für eine verbesserte Reinigungsleistung können Sie auch ein Ultraschallreinigungsgerät kaufen, das über eine Heizung verfügt. In diesem Fall verkürzt sich die Reinigungszeit, jedoch dürfen Desinfektionsmittel nicht über 40 °C erhitzt werden, da ab dieser Temperatur die Eiweißkoagulation eintritt, was die Reinigung und Desinfektion erschwert.
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG, Thermodesinfektoren) sorgen für einen effizienten Workflow und optimierte Arbeitsprozesse. Wiederaufbereitet werden können können diverse thermostabile Medizinprodukte. Ohnehin sind Sie bei einem Medizinprodukt der Risikoklasse “kritisch B” gezwungen, einen Reinigungsdesinfektor einzusetzen (Aktenzeichen 13 A 2422/09) oder auf Einmalartikel umzusteigen. Die bloße Vermutung, dass man mit einem manuellen Aufbereitungsverfahren genauso wirksam arbeitet, wie mit einem maschinellen Verfahren genügt nicht. Zuverlässige validierte Ergebnisse erzielen Sie nur mit einem RDG: Fehler bei Dosierung oder Einhaltung der Einwirkzeiten sind hier ausgeschlossen.
Sterilisatoren
Die vollständige Abtötung von Keimen kann nur durch einen Sterilisator, meist Autoklav, gelingen. Je nach Modell arbeiten diese Geräte nach physikalischem oder chemisch-physikalischem Verfahren. Üblich ist vor allem die Dampfsterilisation mit einem Autoklav.
Weiter wird unterschieden in Sterilisatoren der Klasse B, S und N. Klasse B ist für die Sterilisation aller verpackten und unverpackten Medizinprodukte geeignet. Klasse S kommen nur für Arztpraxen ohne operative Eingriffe in Frage und eignen sich für das sterilisieren von verpackten Medizinprodukten mit einfach zugänglichen Oberflächen. Sterilisatoren der Klasse N eignen sich nur bedingt, da der Dampf die Verpackung nicht wirksam durchdringen kann.
Tipp: Sterilisation lässt sich auch durch UV-Strahlung erreichen. Aktuell ist die Bekämpfung von Coronaviren mit UV-C von großem Wert.
Steckbeckenspüler
Für die maschinelle Instrumentenaufbereitung von Steckbecken und Urinalen gibt es gesonderte Steckbeckenspüler. Dieser Spüler funktioniert im Prinzip wie ein herkömmliches RDG, wurde aber aus hygienischen Gründen eigens für solche Medizinprodukte konzipiert.
Reinigungs und Desinfektionsgeräte für Endoskope (RDG-E)
Medizinische Endoskope sind aufgrund ihres Aufbaus besonders kompliziert wiederaufzubereiten. Viel mehr sind es die flexiblen Endoskope, welche schwer zu reinigende, verzweigte und englumige Kanäle besitzen. Hinzu kommt, dass es aus thermolabilen Komponenten besteht und daher mit einem speziellem Gerät wiederaufbereitet werden sollte: dem RDG-E.
Manuelle Instrumentenaufbereitung
Ist das präferierte maschinelle Aufbereitungsverfahren nicht möglich, so kann man notfalls auf die manuelle Instrumentenaufbereitung zurückgreifen. Ebenso kann sie im Rahmen der Vorreinigung von Medizinprodukten oder bei nicht maschinell zu reinigenden/desinfizierenden Medizinprodukten (Gruppe B) ihre Anwendung finden. Die Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte sowie Reinigungs-/Desinfektionsmittel ist auch hier verpflichtend, sodass das Verfahren standardisiert ablaufen kann Die jeweiligen Herstellerangaben müssen auch hier berücksichtigt werden. Die manuelle Wiederaufbereitung ist auf Wirksamkeit hin zu überprüfen. Zugelassen sind lediglich Desinfektionsmittel, die durch das VAH zugelassen sind.
Während der manuellen Instrumentenaufbereitung ist adäquate Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkittel) zu tragen. Der Ablauf der manuellen Instrumentenreinigung und Desinfektion sieht wie folgt aus:
- Standardarbeitsanweisung (SAA) Vorbereitung von Medizinprodukte einhalten (Grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen, kontaminationssicherer Transport, Zerlegen von Medizinprodukten).
- Abfälle und zu entsorgende Einmalartikel aussortieren.
- Herstellung einer wirksamen Konzentration gemäß Herstellerangaben (Dosieranleitung). Dabei Verwendung geeigneter Instrumentenwannen (Einsatzsieb, Abdeckung) und von Dosierhilfen. Nur die konzentrierte Lösung in das Verdünnungsmittel geben, niemals umgekehrt (Gefahr des Verspritzens ätzender Flüssigkeiten !).
- Sofortiges Einlegen und vollständiges Eintauchen der Medizinprodukte in die Desinfektionslösung (ohne Zwischenlagerung). Bei manuellem Vorgehen ist auf eine blasenfreie, nicht fixierende Reinigung - und Desinfektion zu achten.
- Nach Ablauf der vom Hersteller angegebenen Einwirkungszeit Instrumente, Werkstoffe oder Material vorsichtig entnehmen und unter fließend kaltem Wasser abspülen, um Reinigungs- und Desinfektionsmittelreste zu entfernen.
- Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit, Pflege, Instandsetzung, Funktionsprüfung.
- Kontrolle der Standzeit und des Verschmutzungsgrades nach Herstellerangaben. Entsorgung der Desinfektionsflüssigkeit nach Ablauf der Standzeit.
- Desinfektionsmittel enthalten häufig Gefahrstoffe. Vor Beseitigung der Gebrauchslösung den dafür vorgeschriebenen Weg sicherstellen! Nach Gefahrstoffverordnung muss geprüft werden, ob ein Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist. Anforderung vom Hersteller bei Notwendigkeit.
- Unterweisung erfolgt und dokumentiert Ja/Nein? Wenn ja, dann Angabe von Datum, Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin und Unterschrift
Hier sei nochmal darauf hingewiesen, dass bei Möglichkeit einer maschinellen Instrumentenaufbereitung, diese der manuellen vorzuziehen ist. Überall wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. Die manuelle Instrumentenaufbereitung hat gegenüber der maschinellen folgende Nachteile:
- Inkonsequente Reproduzierbarkeit
- Nicht zu 100 % umsetzbare Standardisierbarkeit
- Personalintensiv
- Höheres Infektionsrisiko für das Personal
Instrumentenaufbereitung in einzelnen Fachbereichen: von Zahnarztpraxis bis Tierarzt
Die Instrumentenaufbereitung wird überall dort benötigt, wo Infektionen durch kontaminierte Medizinprodukte verursacht werden können. Nachfolgend haben wir Ihnen eine Übersicht über wichtige Informationsmaterialien, unterteilt in die einzelne Fachbereiche, zusammengestellt:
Instrumentenaufbereitung in verschiedenen Fachbereichen
| Anwendungsbereich | Quelle | Dokument |
| Zahnarztpraxis | Zahnärztekammer Niedersachsen | Aufbereitung von Medizinprodukten in der zahnärztlichen Praxis |
| Kieferorthopädie | Spitta | Hygienerichtlinien in der Kfo-Praxis – Was gilt es Besonderes zu beachten? |
| HNO Praxis | Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e. V. | Hygienische Aspekte in der Hals-Nasen-Ohren-Praxis |
| Gynäkologie | Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V | Hygienische Aspekte in der gynäkologischen Praxis |
| Ophthalmologie/Augenheilkunde | Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e. V. | Aufbereitung ophthalmologischer Medizinprodukte: Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
| Podologie | Verband der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst Mecklenburg-Vorpommern, Zentralverband der Podologen und Fußpfleger Deutschlands e. v | Hygienegrundsätze in Praxen der Podologen und Fußpfleger |
| Veterinär/Tierarzt | Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung | Instrumentenaufbereitung im Veterinärbereich richtig gemacht |